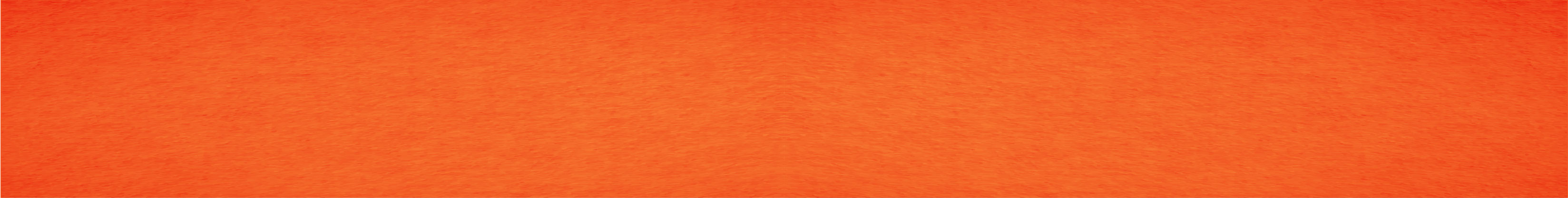Hinweise zum Sehen – Gedanken zu meinen Bildern
Zur Veranschaulichung meiner Arbeitsweise will ich im Folgenden versuchen, einige mir häufig zu meinen Bildern gestellte Fragen zu beantworten:
Wie kommen Sie eigentlich auf Ihre Bildideen?
„Mensch werden ist Kunst“, schrieb Novalis (1772–1801) einmal treffend.
Ich assoziere mit diesem Ausspruch die Entwicklung bzw. Reifung des einzelnen Menschen zum Menschen, seine über die rein biologische Existenz hinausgehende soziale, emotionale und intellektuelle Kompetenz. Diese kann jeweils nur in einem Prozess entstehen, ist nichts per se Gegebenes und unter Umständen – je nach den individuellen Lebensbedingungen des Einzelnen – sogar nicht selten etwas recht Schwieriges.
In diesem Sinne gilt mein Hauptinteresse dem Menschen, wie er handelt, wie er denkt und wie er fühlt, seinen Ängsten, seinen Wünschen, Hoffnungen und Freuden. Den Menschen, seine ihm innewohnende und ihn umgebende Wirklichkeit sehe ich in Formen und Farben, die auf Tatsächliches verweisen, Assoziationen wecken und Wesentliches sichtbar machen können. Sie assoziieren Haltungen und Empfindungen, zeitlose und zeitabhängige gleichermaßen. Sie assoziieren Gefühle – den eigentlichen Motor menschlichen Lebens.
Licht und Schatten als Antipoden – sowohl im konkret malerischen als auch im übertragenen Sinne – sind für mich ganz zentrale Ausdrucksmittel. Immer wieder und nahezu überall treffen sie aufeinander und schaffen Lebendigkeit: das Licht, ohne welches Leben nicht möglich wäre, und der Schatten, ohne welchen das Licht nicht wahrgenommen und wertgeschätzt werden könnte. Damit sind diese beiden Antipoden für mich Essenzials für das – wie Novalis es formulierte – eigentliche Menschwerden. Sie sehe ich in Erfahrungen und Gefühlen, wie sie sicherlich jeder schon einmal irgendwann und irgendwie selber erlebt hat: Schmerz und Glück, Trauer und Freude, Verunsicherung und Sicherheit, Zweifel und Zuversicht, Alleinsein und Miteinander, Stillstand und Bewegung.
In diesem Sinne, so möchte ich Hermann Hesse zitieren, „suchen (wir, die Kunstschaffenden, d.V.) unsere Zeit nicht zu erklären, nicht zu bessern, nicht zu belehren, sondern wir suchen ihr, indem wir unser eigenes Leid und unsere eigenen Träume enthüllen, die Welt der Bilder, die Welt der Seele, die Welt des Erlebens, immer wieder zu öffnen. Diese Träume sind zum Teil arge Angstträume, diese Bilder sind zum Teil grausige Schreckbilder – wir dürfen sie nicht verschönern, wir dürfen nichts weglügen.“ (Hermann Hessen, Prosa und Feuilletons aus dem Nachlass (unveröffentlicht); in: ders., Lektüre für Minuten, Frankfurt/;. 1975, S. 149 f.).
Wonach wählen Sie jeweils Ihre Farben aus?
Häufig werde ich auf meine ab dem Jahr 2000 entstandenen und nur in Blautönen gehaltenen Bilder angesprochen. Ebenso auf die ab 2005 geschaffenen mit ihren leuchtenden Gelb- und Rottönen.
Diese Farben sind nicht beliebig, folgen keinen Vorgaben und dienen keinem dekorativen Zweck. Vielmehr ist die Farbe mein zentrales Ausdrucksmittel. Dazu möchte ich Robert Delaunay zitieren, den ich als Maler sehr schätze:
Die Farbe, so sagt er, sei die Grundlage der bildnerischen Mittel des Malenden. Sie sei seine Sprache.
Die Farbe sei Form und Inhalt zugleich. Sie sei ihre eigene Funktion. Ihre gesamte Bewegung sei in jedem Augenblick präsent. Die Farbe komme nicht bloß zu Linien und Motiven hinzu, sondern sei aufgrund ihrer eigenen Ausdehnung selbst Form, Licht, Atmosphäre, Raum (vgl. Marc, Macke und Delaunay, Katalogband, Hannover 2009, S. 97).
Wie können Sie lediglich mit Farbstiften solche Bilder herstellen?
Oft wird mir Erstaunen über die Farbdichte und Farbbrillanz meiner Bilder entgegengebracht. Mancher Betrachter äußerte sogar die Vermutung, ich würde, ohne Benennung, mit Pastellkreide, Verwischungen oder Flüssigfarbe arbeiten.
Dies aber ist nicht der Fall: Ich arbeite stets mit dem Farbstift. Nur in wenigen meiner Bilder setze ich zwecks Akzentuierung noch einen Hauch Ölkreide ein.
Auch wenn ich meist nur mit Stiften arbeite, verstehe ich mich nicht als Zeichnerin im engeren Sinne. Vielmehr bewege ich mich in einem Grenzbereich zwischen Zeichnung und Malerei: Ich male mit dem Stift.
Bei näherer Betrachtung meiner Bilder wird erkennbar, dass ich weder die fließenden Übergänge von Hell zu Dunkel und umgekehrt noch dunkle bzw. helle Farbflächen in erster Linie durch die Verwendung eines helleren oder dunkleren Stifts erreiche, auch nicht z.B. durch Verwischung.
Vielmehr lege ich in mehreren Arbeitsgängen jeweils eine Farbschicht auf die nächste, bis ich schließlich den von mir gewünschten Farbton gewonnen habe. Auf diese Weise liegen stets mehrere Farbnuancen übereinander, was jene Farbdichte schafft, die manchen Betrachter vermuten ließ, es könne sich dabei nicht um die Textur von Stiften handeln.